1. MEISSEN Symposium
7.11.-9.11.2025
Die Meissen Porzellan-Stiftung ist Gastgeberin des 1. MEISSEN Symposiums. Ziel ist der regelmäßige Austausch am Geburtsort des europäischen Porzellans. Inhalt des diesjährigen Symposiums ist das Erbe Höroldts. Ein kompakter Überblick über Farben, ihre Herstellung, Maltechniken, ihre historische und zeitgenössische Weiterentwicklung und deren Verwendung, in der Manufaktur und darüber hinaus. Anlass für das Symposium ist der 250. Todestag der beiden Größten ihres Genres, Johann Gregorius Höroldt und Johann Joachim Kaendler.
Höroldts Erbe
Als Höroldt um 1720 nach Meißen kam, war das der Durchbruch in der Porzellanmalerei. Höroldt war nicht nur ein innovativer Porzellanmaler sondern auch als Farbenchemiker ein Naturtalent. Er entwickelte die einbrennbaren Porzellanmalfarben auf Metalloxidbasis. Zunächst waren es 16 Farbrezepturen, heute sind es 10.000.
Anfangs stand August dem Starken vor allem der Sinn nach kobaltblauen Unterglasur-Porzellanen, wie das der Chinesen. Mit Johann Gregorius Höroldt begann die Erfolgsgeschichte der Aufglasurmalerei. Zunächst wurden asiatisch inspirierte Dekore entwickelt, später die europäische Blumenmalerei, Kaufahrteiszenen, Jagdszenen, Malereien nach Watteau, Ridinger usw. Die Platinmalerei hielt Einzug, ebenso die Limogesmalerei und die Pâte-sur pâte-Malerei. Gefärbte Massen waren von Anfang ein Experimentierfeld, ebenso die Mischbarkeit von Farben. Davon zeugen heute noch eine Vielzahl an Farbproben, Farbtäfelchen, die genauestens beschriftet und archiviert sind. Die Farben wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Es folgten Scharffeuer-, Inglasur- und Lösungsfarben. Das Fortschreiten der RFA-Analyse ermöglicht inzwischen ungeahnte Erkenntnisse.
Die Referenten und ihre Themen - Fortsetzung folgt ...
Farbproben und -muster der Sammlung der Meissen Porzellan-Stiftung
Ein wichtiger, bisher nicht erforschter Bestand der Sammlung der Meissen Porzellan-Stiftung sind Farbproben und -muster. Der Vortrag stellt den facettenreichen Bestand vor. Proben aus dem frühen 19. Jahrhundert entstanden noch auf der Meißener Albrechtsburg, der ersten Produktionsstätte der Manufaktur. Aus den 1870er und 1880er Jahren existieren Proben für Farbfonds. Rudolf Hentschel testete um 1898 Lösungsfarben für seine Dekore. Muster aus dem frühen 20. Jahrhundert preisen die breite Farbpalette und ihre Brillanz. Auch aus der Direktoratszeit von Max Adolf Pfeiffer (1918 – 1933) existieren Muster für Aufglasurfarben. Zu den jüngeren Proben zählen Skizzen en miniature, in denen Landschafts- und Figurenmaler Farben und deren Mischungsverhältnis testeten. Zudem stellen sich Porzellanmaler schon in der Ausbildung nummerierte oder mit dem Farbnamen bezeichnete Farbmuster für ihre Dekore her. „Fingeraufstriche“ sind Qualitätstests aus der Farbenherstellung der Manufaktur: Jede neue Charge einer Farbe wird mit dem Finger auf Porzellan gestrichen und als Test gebrannt, bevor sie an in die Malerei geliefert wird.
Mit Roentgenstrahlen in die Fürstenberg-Vergangenheit blicken
Die Anwendung naturwissenschaftlicher Analysemethoden zur Klärung von Echtheits- und Datierungsfragen bei historischen Porzellanen ist vor allem bei der Untersuchung von Meissener Erzeugnissen mittlerweile etabliert. Anders verhält es sich bei den Porzellanen der sogenannten „kleinen“ Manufakturen wie Fürstenberg. Seit einigen Jahren verfolgen das Museum Schloss Fürstenberg und der Freundeskreis Fürstenberger Porzellan e. V. zusammen mit den Universitäten in Cranfield (UK) und Leiden (NL) ein Projekt, um mittels Roentgenfluoreszenzanalyse zu neuen Erkenntnissen über die Fürstenberger Porzellanproduktion des 18. Jahrhunderts zu gelangen. Welche Fragen sich stellen, vor welchen Herausforderungen die Projektpartner stehen und welche ersten Ergebnisse bereits erzielt werden konnten, sind das Thema des Redebeitrags.
Wo sind all die weißen Figuren? Später dekoriertes Meissener Porzellan
In diesem Vortrag wird Dr. Vanessa Sigalas neue Ergebnisse ihres Forschungsprojekts vorstellen, bei dem wissenschaftliche Methoden - insbesondere die Röntgenfluoreszenzspektroskopie (XRF) - auf eine bedeutende Privatsammlung von Meissener Porzellanfiguren und -gruppen angewendet wurden. Diese groß angelegte Studie, die erste ihrer Art, schlägt ein neues Kapitel in der Erforschung des Porzellandekors auf und wirft wichtige Fragen zu Authentizität, Kennerschaft und Sammelpraxis auf. Anhand der jüngsten Analyse der Alan Shimmerman Collection wird Dr. Sigalas erörtern, was die technische Untersuchung über die Datierung von Porzellandekoren offenbaren kann und was diese Entdeckungen für unser Verständnis der Meissener Produktion im 18. und 19. Jahrhundert bedeutet.
Befragungen an das Rot
In dem Vortrag „Befragungen an das Rot“ führt die Kieler Konzeptkünstlerin und Bildhauerin Lena Kaapke in ihr langjähriges Ausstellungsprojekt zur keramischen Farbe Rot ein. Seit zehn Jahre arbeitet sie an einem Werkzyklus, der das keramische Rot befragt. Unterschiedliche Arbeiten und Installationen befragen unterschiedliche Eigenschaften, Bedingungen, Prozesse, Traditionen und Anwendungen des keramischen Rots und stellen dabei die herkömmliche und die den Betrachtenden aus anderen Medien bekannte Definition von Farbe in Frage. Sie fordern auf, diese für die Keramik neu zu denken. Werden die Arbeiten zusammen gesehen, ergeben sich Verknüpfungen, die einen sinnlichen Farb- und Gedankenraum eröffnen, indem keramische Farbe räumlich, zeitlich und performativ verortet wird. Keramische Farbe wird zum Anlass für die künstlerische Arbeit und somit zum Mittel zeitgenössischer Konzeptkunst erhoben. Die Vermessung des Rots führt Lena Kaapke zur Herleitung einer philosophischen Notation des konzeptionellen Potentials der Farbe Rot.

Neue Ansätze zur Erforschung der (Miniatur-)Malerei
Im Jahr 1721 waren in der Meissener Manufaktur sieben Porzellanmaler beschäftigt, 1735 waren es 57 und bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1756 bereits 219. Diese Künstler wurden größtenteils intern ausgebildet, um anonym im Stil der Manufaktur in dem einen oder anderen Genre zu malen. Dieses Produktionssystem ähnelte den Werkstätten am Dresdner Hof, wo Maler verschiedenster Fachrichtungen für Leinwandbilder; Miniaturmalereien auf Metall, Elfenbein oder Alabaster; Aquarell-, Buch- und Tuschemalerei; Lackarbeiten und Vergoldung – gemeinsam an höfischen Aufträgen arbeiteten. Abgesehen von den technischen Besonderheiten der Herstellung, erforderte die Porzellanmalerei die gleiche Art von Ausbildung, Fachwissen, Designstrategien und Zusammenarbeit, wie sie in der Gemeinschaft der Künstler und Kunsthandwerker im Dienste des Dresdner Hofes zu finden war. Vor diesem Hintergrund stellt Maureen Cassidy-Geiger in ihrem Vortrag neue Ansätze zur Erforschung der (Miniatur-)Malerei auf Meissener Porzellan vor.
Einfluss der Brandführung auf keramische Farben
Keramische Farben beziehungsweise Farbkörper zeigen bei verschiedenen Brandführungen unterschiedliche Farbentwicklungen. Die maßgeblichen Faktoren sind die Brenntemperatur, die Haltezeit und die Atmosphäre. Diese Einflussfaktoren werden anhand ihrer Wirkung beschrieben.
Wer beeinflusste Höroldt: Gedanken zu den Ursprüngen von Höroldts technologischen Fortschritten
Der Einfluss von Höroldts Innovationen auf die Techniken der Porzellanmalerei in Deutschland, Europa und darüber hinaus ist kaum zu bestreiten. Doch was waren die Quellen, die Höroldts Denken leiteten? Nur eine Handvoll seiner Pigmente war zur damaligen Zeit allgemein bei Töpfern in Gebrauch. Eine genaue Untersuchung des Textes von mindestens drei seiner Rezepte zeigt den direkten Einfluss der Schriften bestimmter Alchemisten und Glasmacher des 16. und 17. Jahrhunderts. Andere Verfahren, wie etwa die Fällung von relativ reinem Cobaltcarbonat zur Verwendung in Aufglasurblau-Emailfarben, scheinen hingegen vollständig von Höroldt selbst erfunden worden zu sein.
Einblicke in die technologischen Grundlagen der farbigen Porzellan-Dekoration
Entdecken Sie die faszinierende Welt der Porzellan-Dekoration! Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Porzellan farbig zu gestalten und die Farben dauerhaft zu fixieren. Jede Methode bringt jedoch ihre eigenen Vor- und Nachteile mit sich, und im technologischen Prozess beeinflussen sich viele Faktoren gegenseitig. Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die verschiedenen Techniken, wie Aufglasur- und Unterglasurdekorationen, ihre Qualität, optische Effekte und die Farbpalette. Außerdem werden die handwerklichen und technologischen Herausforderungen beleuchtet, die bei der Herstellung auftreten. Erfahren Sie die Zusammenhänge zwischen wichtigen Einflussgrößen und gewinnen Sie spannende Einblicke in die Arbeitsabläufe – sowohl auf handwerklicher als auch auf technischer Ebene.

Frankenthaler Farben – Von Meissen in die Pfalz
Die 1755 durch den aus Straßburg stammenden Paul Hannong in Frankenthal gegründete Porzellanmanufaktur bestand nur etwas weniger als 50 Jahre. Bereits in Straßburg führten die Löwenfinck-Brüder für die Fayenceproduktion Meissener Farben im Elsass ein. Darauf folgte eine kontinuierliche Weiterentwicklung, vor allem unter dem Manufakturdirektor Simon Feylner ab 1775. Ein erhaltener Arkanumskoffer sowie zwei „Farben-Probteller“ aus dieser Zeit geben dabei Aufschluss über den Variantenreichtum der Frankenthaler Muffelfarben, die zu Feylners Amtsbeginn bereits 60 verschiedene Farbtöne abdeckten. In den 1780er Jahren entwickelte er zudem verschiedene Auf- und Unterglasurfarben, die bis heute charakteristisch für Frankenthaler Erzeugnisse sind. Im Vortrag werden neben der Erläuterung der Farbproben exemplarische Beispiele der für Frankenthal besonderen Farben vorgestellt.
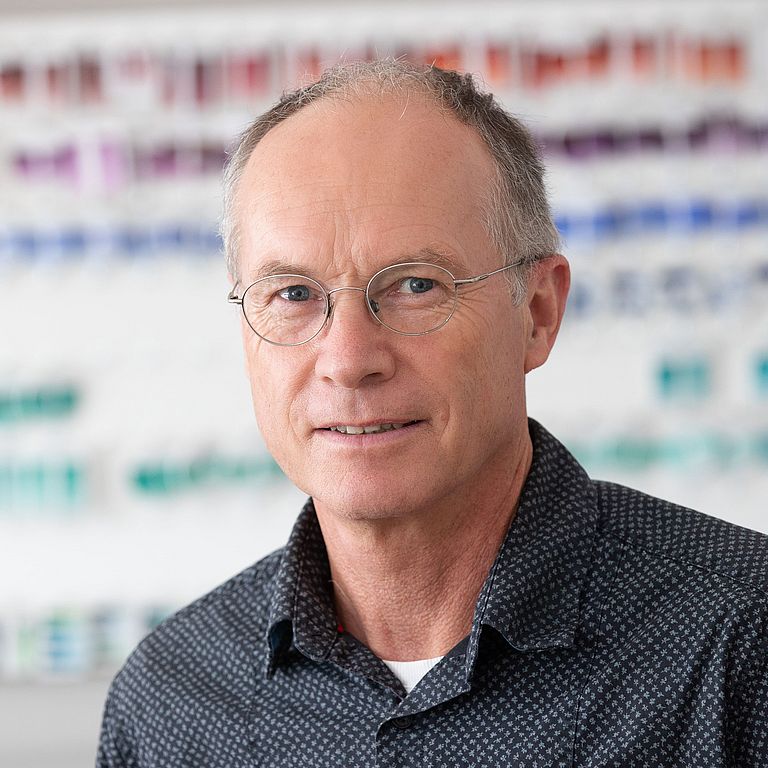
Die Farben bei Meissen, eine Herausforderung zur Dekorentwicklung
Der Vortrag eröffnet mit einem kompakten Überblick über die spannenden Anfangsjahre der Meissener Manufaktur in Bezug auf Farbentwicklung sowie Dekorationstechniken wie Unterglasur- und Aufglasurmalerei. Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Farbvielfalt und ihre kreative Wechselwirkung mit der Dekorentwicklung – ein Prozess gegenseitiger Inspiration und Befruchtung. Anhand ausgewählter Praxisbeispiele werden die unterschiedlichen Eigenschaften und Gestaltungsmöglichkeiten neuer Farbtöne und Auftragstechniken anschaulich vorgestellt.
Vor-Ort-Analyse von emailliertem Porzellan durch Raman- und Röntgenfluoreszenzspektroskopie: Identifizierung anhand von Spektralsignaturen
Zwei Spektroskopien, Raman-Streuung und Röntgenfluoreszenz, können vor Ort mit tragbaren Instrumenten auf völlig nichtinvasive Weise und daher an seltenen Objekten durchgeführt werden. Wir zeigen die Komplementarität dieser Methoden für die halbquantitative Identifizierung von amorphen oder kristallinen Phasen (Raman) und der meisten Elemente, die schwerer als Natrium sind (XRF), aus denen sie bestehen. Dieses Verfahren wird auf europäisches und asiatisches (über)glasiertes Porzellan angewandt, um Technologietransfers und die Herkunft der Rohstoffe mit Hilfe spezifischer experimenteller und datenverarbeitender Verfahren (ternäre Diagramme, PCA, hierarchische Klassifizierung) zu identifizieren. Als Beispiele werden wir die Identifizierung der Herkunft von Kobalt (Smalte), Techniken zur Herstellung von Goldnanopartikeln für Rosa und Violett und die Identifizierung von Gelbpigmenten in Porzellan aus Saint-Cloud, Meissen, Sèvres usw. und Japan aus Arita (17. Jahrhundert) oder dem chinesischen Qing (18. Jahrhundert) anführen.
Von der Restaurierung zur Zuschreibung: Wissenschaftliche und stilistische Neubewertung einer Meissener Jägerinnenfigur
Diese Präsentation konzentriert sich auf eine Hartporzellanfigur, die im 18. Jahrhundert in der Meissener Manufaktur hergestellt wurde und heute Teil der Porzellansammlung der Königlichen Museen für Kunst und Geschichte in Brüssel ist. Die Figur stellt eine Jägerin dar und ist mit polychromen Grand-Feu-Emails verziert. Durch eine Kombination aus stilistischer Analyse und Materialcharakterisierung wurde die Figur in ihrem historischen Produktionsumfeld interpretiert. Die Zusammensetzung der Glasuren beeinflussen, in Korrelation gesetzt mit historischen Produktionsdaten aus der Meissener Manufaktur, nicht nur den Restaurierungsansatz, sondern auch die vorgeschlagene Zuschreibung und Datierung des Stücks.
Tickets und Programm
Newsletter
Melden Sie sich hier zu unserem Newsletter an. In unregelmäßigen Abständen informieren wir Sie über Neuigkeiten und Wissenswertes rund um das 1. MEISSEN Symposium. Wer sind die Speaker, wann kann man sich registrieren, wie sieht das Rahmenprogramm aus. Freuen Sie sich auf drei interessante Tage zum Netzwerken und Austauschen. Die Sprache des Symposiums ist Englisch.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Veranstaltungsort: Erlebniswelt Haus MEISSEN - Talstraße 9 - 01662 Meißen
Planen Sie hier Ihre Anreise.












